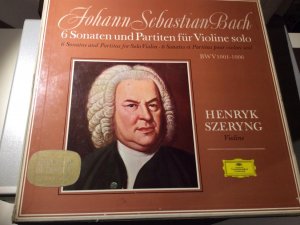Der Urahn dieser hervorragenden Direct-Drive Halb- und Vollautomaten ist der KD-500 aus dem Jahr 1976. Dieser wurde von Kenwood seinerzeit als Studiolaufwerk bezeichnet und ohne Tonarm ausgeliefert, jedoch mit Tonarm auch als KD-550 angeboten. Zwei Jahre später, die Nachfrage wurde stets größer, erweiterte man die Modellpalette und verbesserte die Grundkonstruktion. Als Grundmodell und Nachfolger des KD-500 wurde nun der KD-600 angeboten. Dieser war auch mit Tonarm als KD-650 erhältlich, doch die Anzahl der ohne Tonarm verkauften Laufwerke war nur sehr gering, so gab es nach dem KD-600 nur noch komplette Plattenspieler bei Kenwood. Die KD-500 und 600 hatten ein eigenwilliges Aussehen, da Ihre Zarge aus hellem Kunststoff/Holz-gemisch hergestellt war, welches man an der Oberfläche ein gesteinartiges Finish verpasste, so daß der Eindruck enstand, es handle sich um eine massive Jurasteinplatte oder gar Marmor. Die Tonarme waren sehr solide und hübsch gestaltet, alle in S-Form und mit mittelgroßer bewegter Masse. Angeregt durch den Erfolg der 500/600er-Baureihe wagte Kenwood noch im Jahr 1979 den Sprung in die Vollautomatisierung und änderte gleichzeitig das Aussehen, indem man die Zargen nun aus Preßspan/Kunstststoff-Legierungen mit Klavierlackfinish produzierte. Das Spitzenmodell war der KD-850 als Vollautomat mit weiter verfeinertem Antrieb - im Grunde aber noch immer ein KD-500! Dem KD-850 stellte man einen kleinen Bruder den KD-750 zur Seite, der keine Tonarmsteuerung hatte, ansonsten aber weitgehend baugleich war. Das Design hatte man an den Konkurrenten Denon angepaßt, die in diesem Jahr in die Märkte drangen und mit Ihren Plattenspielern große Erfolge verzeichnen konnten. Über all diesen Modellen trohnte natürlich der L-07D, der einer der besten Plattenspieler aller Zeiten war, mit knapp 5.000,- DM auch für kaum jemand erschwinglich. Jürgen Heiliger hat wohl sogar zwei davon, der Glückliche. Die anderen waren aber auch nicht billig. Für einen KD-500 waren rund 600,- DM, für den KD-550 rund 800,- DM anzulegen. Der teuerste, der KD-850, schlug mit ca. 1.400,- DM ohne System zu Buche, die anderen Modelle lagen dazwischen.
Damit war seinerzeit der Zenit der Plattenspielerentwicklung überschritten. Thorens hatte seinen TD-126MKIII und den Reference, Denon den DP-59 und sein DP-100 Laufwerk und alle anderen hatten ebenfalls gute bis sehr gute Laufwerke abgeliefert - aber die CD war soeben geboren worden und alle Hersteller richteten ihren Fokus auf diese neue Technologie, die Plattenspieler gerieten eindeutig in die Kategorie Nebensächlichkeiten. Digital hieß das neue Zauberwort.
Kenwood hatte aber nach wie vor rege Nachfrage nach hochwertigen Plattenspielern zu verzeichnen, weil auch 1982 zu jeder vernünftigen Anlage noch immer ein Plattenspieler gehörte - niemand wagte es, darauf zu verzichten - schließlich besaßen die meisten ja auch noch etliche Schallplatten. So entstand als Nachfolger der berühmten Baureihe der KD-700, immer noch technisch eng verwandt mit dem KD-500, jedoch inzwischen mit einem geraden Tonarm ausgestattet und noch immer der gleichen Überzeugung folgend ohne jede Tonarmsteuerung, soll heißen, am Plattenende wurde lediglich der Tonarm angehoben und das Laufwerk gestoppt - keine Tonarmrückführung zur Stütze! Man nannte dies "Auto Lift Up Turntable". Um jeden Audiophilen zu überzeugen geschah die Abschaltung am Plattenende per Lichtschranke - also ohne jeden mechanischen Widerstand! Der große Unterschied zu allen seinen Vorgängern lag in seinem nunmehr geraden Tonarm, der nur noch relativ wenig bewegte Masse besaß, also für Systeme mit höherer Nadelnachgiebigkeit geeignet war. Der KD-700D lief einige Jahre als Spitzenplattenspieler im Kenwood-Pogramm und kostete ca. 1000,- DM ohne System. 1986 löste Kenwood den KD-700D durch den KD-990 ab, der nunmehr mit einem J-förmigen Tonarm, der dem L-07D-Arm nachempfunden war, ohne dessen Solidität und Austattung auch nur annähernd zu erreichen, der aber auch über eine wieder höhere bewegte Masse verfügte. Er bediente durchaus bereits nostalgische Gedanken und hatte auch beachtlichen Verkaufserfolg und konnte sich bis 1988 halten. Auch er war immer noch als Auto-Lift-Up konzipiert. Dann wurde er vom KD-7010 abgelöst, der immer noch den J-Tonarm hatte und aber als Novität nunmehr als Halbautomat, also mit mechanischer Tonarmrückführung, ausgestattet war. Auch er hatte immer noch die schwarze in Klavierlack gehaltene Zarge und kostete auch 1990 immer noch 1.000,- DM ohne System. Als nächster in dieser Ahnengalerie taucht dann der KD-8030 auf, der 1991 herauskam, der nunmehr wieder mit geradem Tonarm und vereinfachter Zarge angeboten wurde, die Nachfrage nach Plattenspielern ging halt immer weiter zurück. Aber auch dieser mutet noch immer sehr hochwertig an und ist ein gern gesehener "Klassiker". Er hielt sich wacker bis 1996 im Kenwood-Angebot und kostete zum Schluß ca. 1.200,- DM ohne System. Danach bot Kenwood keine Plattenspieler mehr an, jedenfalls behaupte ich von den Modellen, die danach noch im Katalog waren (KD-492, KD-110), daß sie nicht den Tatbestand eines Plattenspielers erfüllten. Leider.
Interessant an dieser Gechichte ist, daß Kenwood alle Geräte dieser Modellreihe selbst entwickelt hat und sie auch nicht als Derivate an andere Hersteller weitergab. Dies ist erstaunlich, weil Kenwood im Vergleich zu anderen Markenriesen wie Sony (Sony, Aiwa, Wega, Canton) oder Matsushita (Panasonic/Technics/JVC) ein Zwerg ist. In den besten Zeiten haben bei Kenwood 17.000 Leute weltweit gearbeitet, Matsushita brachte es damals auf 250.000, Sony immerhin noch auf 220.000 Mitarbeiter.