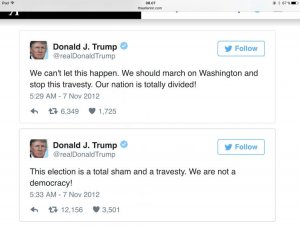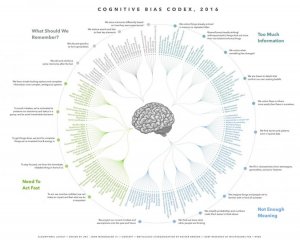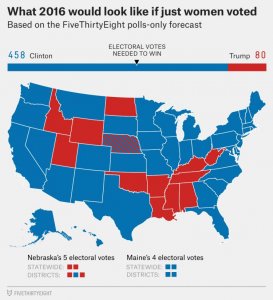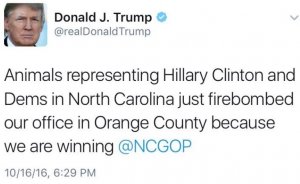Wahlkampf in den USA: Sind die Amis verrückt? | ZEIT ONLINE
Wäre da nicht die apokalyptische Drohung einer Präsidentschaft Trumps, könnte das jeder sehen: Hillary Clinton ist sich selbst Hypothek genug.
Ihr Umgang mit Staatsgeheimnissen in amtlichen E-Mails brachte der Außenministerin das offizielle Urteil ein, sie habe zwar "nicht kriminell, nur verantwortungslos" gehandelt. Nach einer Recherche der New York Times ließe sich das Gleiche über ihre treibende Rolle bei der Libyen-Intervention sagen. Clinton gab den Ausschlag für die Entscheidung zum Krieg und zum Wechsel der Mission – von der Verhinderung eines Massakers zum Regimewechsel. Auch die fahrige Begleitung des Landes nach dem Sturz Gaddafis ist ihr zuzurechnen und damit eine Mitverantwortung für die Zerstörung Libyens, für die Ausbreitung des "Islamischen Staates" in Nordafrika und für die Massenflucht übers Mittelmeer, um deren Opfer sich nicht die USA kümmern, sondern Europa. Über Clintons fahrlässige Außenpolitik gibt es trotz alldem bis heute keine ernsthafte Diskussion.
Und dann ist da noch ihre größte Schwäche – das äußerst kuschelige Verhältnis der Kandidatin (und ihres Mannes) zu jenen Wall-Street-Firmen, die die Finanzkrise mit herbeigeführt haben. Nach Recherchen des wirtschaftsliberalen Nachrichtenmagazins TheEconomist (das Clinton unterstützt und Trump bekämpft) haben die Clintons seit Bills Ausscheiden aus dem Amt 154 Millionen Dollar mit Reden verdient. Immer wieder auch zum Beispiel bei Goldman Sachs (dort allein zwölf Mal). Von den 23 weltweit als "systemrelevant" angesehenen Banken haben zwölf üppige Honorare an die Clintons gezahlt. Hillary Clinton hat in ihrer Zeit als Außenministerin zwar eine Pause eingelegt, doch dafür stiegen die Honorare ihres Mannes in ihrer Amtszeit auf das Doppelte, besonders bei lukrativen Auftritten im Ausland, zwischen Moskau, Dschidda und Peking. Am Ende von Hillarys Amtszeit nahm Bill Clinton bis zu 500.000 Dollar pro Auftritt.
Eine ähnliche Vermischung von öffentlicher Funktion und privatem Nutzen rückt die Clinton-Stiftung ins Zwielicht. Sie verfolgt durchaus hehre Ziele wie die Bekämpfung von HIV-Infektionen. Doch der Economist schätzt, dass 154 Millionen Dollar des Stiftungsvermögens von ausländischen Regierungen kommen, und davon mindestens 54 Millionen von autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und Kuwait.
Es geht nicht darum, die klebrige Clintonsche Melange aus Humanitarismus, Bereicherung und Celebrity-Sucht mit Donald Trumps Imperium aus Lügen, Bankrott, Steuertrickserei und Hasspolitik auf eine moralische Stufe zu stellen.
Und doch ist der Schaden schon wegen der bloßen Distanzlosigkeit gewaltig. Es ist ein Problem, dass diese politische Dynastie (Tochter Chelsea im Vorstand der Stiftung bereits eingeschlossen) eine derartige Nähe zu ebenjener Sphäre der Wirtschaft pflegt, die spätestens seit der Finanzkrise mehr politische Kontrolle und Transparenz brauchte. Und wer soll glauben, dass einflussreiche globale Spieler wie die Saudis ihre Millionen ohne Hintergedanken überweisen? Wer sich von geschworenen Feinden der Freiheit finanzieren lässt, käme in jeder normalen Wahl wohl kaum als Präsidentin der "Heimat der Freien" infrage.
Aber dies ist eben keine normale Wahl. Das beste denkbare Ergebnis ist, dass das Erschrecken vor Trump die eigentlich unwählbare Hillary Clinton ins Amt fegt.